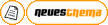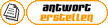|
DVDuell.de Forum
..::: Blu-ray | DVD | Film | Kino :::..
|
| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
helmi

Anmeldungsdatum: 10.03.2005
Beiträge: 2820
Wohnort: Hall of the incredible macro Knight
|
 Verfasst am: 16 Jun 2008 14:58 Titel: sind digital gedrehte kinofilme eine gefahr fürs kino? Verfasst am: 16 Jun 2008 14:58 Titel: sind digital gedrehte kinofilme eine gefahr fürs kino? |
 |
|
in letzter zeit werden immer häufiger spielfilme digital in HD gedreht, z. bsp. "zodiac" von fincher, "nichts als gespenster" von gypkens oder auch "i'm a cyborg, but thats ok" von park chan-wook.
habt ihr beim schauen der filme im kino, auf DVD oder BD irgendwelche unterschiede zu auf 35mm material gedrehten filmen feststellen können?
sind digital gedrehte filme eurer meinung nach eine gefahr für anspruchsvolles kino? wird bei digi-filmen eher geschludert?
ist euch egal, auf welchem trägermaterial ein film entsteht, solange das resultat brauchbar ist?
schaut ihr euch digital gedrehte filme nur an, wenn sie mindestens in 4K gedreht und auch so vorgeführt werden?
gruss
helmut |
|
| Nach oben |
|
 |
Der Mann mit dem Plan
Gast
|
 Verfasst am: 16 Jun 2008 16:53 Titel: Verfasst am: 16 Jun 2008 16:53 Titel: |
 |
|
Da merkt man doch schon das ursprüngliche Problem in der Fragestellung: "sind digital gedrehte kinofilme eine gefahr fürs kino?"
Natürlich ist es immer das Kino selber, beziehungsweise seine technopolitischen Folgerichtigkeiten, das eine Gefahr für sich darstellt. Ob es nun unbedingt das "digitale Kino" sein wird, das die Kunst abtöten wird, halte ich für unfraglich. Erstmal müsste man sich darüber unterhalten, was denn mit "digitalem Kino" gemeint sei. Die digital gedrehten, aber dank Adaptern und nachträglichem Grading auf eine stimmige 35mm-Ästhetik hingearbeiteten Kinofilme ZODIAC oder I'M A CYBORG BUT IT'S OK, werden ja schließlich auch wieder von 35mm-Material im Kino projeziert, und gleichen sich dem Look des Filmmaterials an. Da, wo man mit günstigen HDV- oder gar miniDV-Varianten dreht, und sich nicht vor dem gestochenen Videolook scheucht, da ist doch sogar eine Chance für eine neue Ästhetik - das hat uns doch nun sogar David Lynch vorgemacht.
Warum man digital gedrehte Filme erst ab 4k sehen sollte, bleibt mir an der gesamten Fragestellung am Schleierhaftesten. Die ganze Videokunst- und No- bis Low-Budget-Kurzfilmszene würde da ja urplötzlich über den Tellerrand schwappen. Und beides möchte ich natürlich nicht missen.
Doch die eigenartigste Frage ist doch die, ob digitale Aufnahmeverfahren den Anspruch bedingen sollten? Die Analogie sehe ich nicht für fünf Cent. Und auch nicht, warum "Geschludere" etwas mit Anspruch zu tun haben soll? |
|
| Nach oben |
|
 |
bodycounter
Anmeldungsdatum: 29.04.2008
Beiträge: 211
|
 Verfasst am: 16 Jun 2008 20:22 Titel: Verfasst am: 16 Jun 2008 20:22 Titel: |
 |
|
Für mich hat dieses Thema vor Allem mit Traditionsbruch zu tun, so eine schöne Filmrolle sieht einfach besser aus als ne mini-DV Kassette. Ansonsten ist mir das Material egal, die Bildqualität muss stimmen. Was für die digitale Form spricht ist die Tatsache, das die Filme nicht vermodern und später keiner Restaurierung bedürfen.
_________________
Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. |
|
| Nach oben |
|
 |
Dr. Strangelove

Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge: 1806
|
 Verfasst am: 16 Jun 2008 22:20 Titel: Verfasst am: 16 Jun 2008 22:20 Titel: |
 |
|
Das digitale Material hat eine Art Demokratisierung beim Filmemachen eingeleitet, da die variablen Kosten für das klassische Filmmaterial wegfallen. Was beim Blockbuster nicht so ins Gewicht fällt, kann bei kleinen Filmen entscheidend sein. Lynch wurde ja oben schon zitiert, die digitale Technik erlaubte es ihm beispielsweise, jahrelang herumzuexperimentieren und dabei seinem avisierten Ziel immer näher zu kommen, ohne sich einen Kopf über die Kosten machen zu müssen. Als ein Straub in den 80ern "Klassenverhältnisse" drehte, jammerte er über die horrenden Kosten, die seine oft fast über hundert Takes erzeugten.
Das Entscheidende ist für mich jedoch nicht das Filmmaterial, sondern die neuen Ideen, die ein Regisseur hat. Wenn er auf digitalem Material nichts zu sagen hat, dann nützt ihm auch 35mm-Film nichts.
Man könnte als Beispiel einen Stroheim-Film anführen. Obwohl die Mehrzahl seiner Werke verstümmelt wurde, könnte man eine xbeliebige, kurze Szene herausziehen und wäre angesichts der Ideenreichtums, der Schaupielpräsenz oder der Inszenierung beindruckt. Und das liegt nicht am Filmmaterial.
Lynch sprach mal von "A Room to dream". In diesem Sinne gibt der digitale Film dem Regisseur tatsächlich mehr "Raum zum Träumen", und zu deren Realisierung. Und das finde ich wunderbar!
_________________
"Un artiste est toujours jeune" Jean-Marie Straub |
|
| Nach oben |
|
 |
helmi

Anmeldungsdatum: 10.03.2005
Beiträge: 2820
Wohnort: Hall of the incredible macro Knight
|
 Verfasst am: 30 Jun 2008 11:50 Titel: Verfasst am: 30 Jun 2008 11:50 Titel: |
 |
|
hier noch ein zum thema passender beitrag aus der nächsten FD ausgabe.
Abenteuer: Kino artikel / veranstaltung
Digitales Kino, Chaos und das Internet. Themen beim medienforum.nrw
[ zurück ]
Mit Filmfinanzierung, Marketing oder auch dem Special „Inflation Romanverfilmung“ ging das 20. medienforum.nrw in Köln (9.-11.6.) und mithin der Internationale Filmkongress der Filmstiftung NRW seinen gewohnt fundierten Gang. Dass es unter der geschäftig-kollegialen Oberfläche der Branche freilich kräftig brodelt, zeigten die zentralen Panels der Veranstaltung über die bevorstehende digitale Revolution in den Kinosälen. Während sich die Independent-Regisseure schon seit geraumer Zeit kostengünstiger Digitalästhetik bedienen und ihren Ansatz mehr oder minder geschickt als Kunst verkaufen; während die US-Majors schon an aufwändig erstellten High-Definition-Filmen basteln und die dritte Film-Dimension noch in diesem Jahrzehnt für unsere Kinos prophezeien, bekommt der normale Kinobetreiber von nebenan langsam Torschlusspanik. „Wer soll das bezahlen?“, prangte denn auch provokant über der Diskussionsrunde, die mit Funktionären der Theater- sowie der Verleiher-Lobby sowie engagierten Filmkunstkinobetreibern (fast) perfekt besetzt wurde. Da sich die Frage nach Sinn und Nutzen des „Systemwechsels“ nicht mehr stellt und das Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit auch von den vehementesten Kulturpessimisten nicht mehr aufzuhalten ist, werden erst einmal fleißig die (Phantom-)Wunden geleckt.
Eine Umrüstung vom alten, nahezu ewig haltenden 35mm-Projektor zur voller Kinderkrankheiten steckenden neuen Digitaltechnologie würde jede Leinwand gut 60.000 Euro kosten, so Andreas Kramer, Geschäftsführer des Hauptverbands Deutscher Filmtheater. Pro Monat kämen stattliche 275 Euro allein an erhöhten Betriebskosten hinzu. Spätestens nach acht Jahren wäre dann ob der anfälligen Elektronik/Optik und der sich rasant weiterentwickelnden Technologie ein komplett neuer Projektor fällig. Solche Kosten dürften jedes mittelständische Kinounternehmen in den Ruin treiben. Von den sich für die deutsche Kinolandschaft aufaddierenden Gesamtkosten in deutlich dreistelliger Millionenhöhe, so haben erste Verhandlungen ergeben, könnten jeweils ein Drittel die Kinos, die Filmverleiher und die öffentliche Hand übernehmen. Spätestens da fragt man sich grundsätzlich schon, warum der Steuerzahler eine technische Innovation mitbezahlen soll, die vornehmlich den Majors bessere resp. kostengünstigere Vertriebswege für ihr Produkt ebnen soll; vor allem, wenn der Obolus für die vermeintlich bessere Bilderlebnisqualität im Kino ohnehin schon vom Kinogänger durch höhere Eintrittspreise zu entrichten sein wird. Hier sticht plötzlich der von Kino- und Verleih-Seite unisono vorgebrachte und ja nicht zu leugnende Joker „Kulturgut“. Gerade jenen Abspielstätten, in denen weniger Hollywood als die Filmkunst regiert, könnte die Filmförderungsanstalt (FFA) helfend unter die Arme greifen. Ansonsten ist für Johannes Klingsporn, Geschäftsführer der Filmverleiher, alles ganz einfach: Bei jenen Kinos, wo es sich aus Verleihersicht lohnen würde, könne auch die Hälfte der Investitionen übernommen werden – Darwins Lehren sind im „Kulturgut“ Kino längst angekommen.
Ohnehin verstand Klingsporn die ganze Panik nicht und beklagte sich darüber, dass auf dem Panel positiv denkende Vertreter fehlen würden. In der Tat wäre es interessant gewesen, aus erster Hand von einem bereits fleißig digitalisierenden Multiplex-Betreiber mehr über den Alltag mit dem neuen Medium zu erfahren. So aber dominierte die Wut seitens der Arthaus-Kinobetreiber, allen voran Catherine Laakmann, Geschäftsführerin der „Metropolis“ Lichtspieltheater in Köln, ob der offensichtlichen Ignoranz der Verleiher. Eindrücklich war dagegen der interessante Erfahrungsbericht von Karl-Heinz Somnitz, Geschäftsführer der Düsseldorfer Filmkunstkinos, der über die chronische Unzuverlässigkeit und die finanzielle Unkalkulierbarkeit einer in bestimmten Fällen noch unausgegorenen Digitaltechnik referierte. Spätestens hier kann es dann auch dem Kinogänger mulmig werden, wenn mit großen Worten – offensichtlich über die Köpfe der Kinobetreiber hinweg – der Systemwechsel proklamiert wird. Eingedenk der Tatsache, dass in vielen Multiplexen und Filmkunstkinos noch nicht einmal die solide Anwendung der alten Technik beherrscht wird und zu unbefriedigenden Bild- und Tonergebnissen führt, scheint das „Abenteuer: Kino“ für den Zuschauer eine ganz neue Bedeutung zu bekommen.
Aber wer weiß, vielleicht findet die Zukunft des Films immer weniger im Kino und gänzlich ohne die Verleiher statt. Die Gefahren, vor allem aber die Chancen der digitalen Filmauswertung erörterte nicht minder engagiert eine weitere Diskussionsrunde. Vor allem C. Cay Wesnigk, Vorstand der Onlinefilm AG, Regisseur und Produzent, wittert endlich einen freien Filmmarkt im digitalen Zeitalter. Wenn es nach ihm ginge, fänden Vermarktung und Präsentation von Filmen nicht mehr durch Verleiher via digitaler Projektion im Kino statt, sondern via kommerziellem Portal im Internet. Mit dem griffigen Slogan „Films are made to be seen“ ist die Plattform www.onlinefilm.org angetreten, um zwischen Raubkopierern einerseits und den Profit selektierenden Verleihern andererseits eine Nische für Produzenten und Regisseure zu öffnen und Filme global und vor allem zum Nutzen der Urheber zu vermarkten. Auch den Niederländern ist es daran gelegen, alle ihre Filme via Internet „reisen“ zu lassen. So berichtete Petra Goedings von Phanta Vision Film (Amsterdam), dass der holländische Staat gerade dabei ist, 173 Mio. Euro bereitzustellen, um binnen fünf Jahren sämtliche Filme des Landes zu digitalisieren und sie im Netz auf einer zentralen Plattform zu vermarkten; eine zunächst europäische Vernetzung ist angedacht. Während sich also die Gewaltigen streiten, könnten sich die Urheber bald freuen. Das Kino bliebe freilich auf der Strecke – schöne Aussichten.
gruss
helmut |
|
| Nach oben |
|
 |
helmi

Anmeldungsdatum: 10.03.2005
Beiträge: 2820
Wohnort: Hall of the incredible macro Knight
|
 Verfasst am: 28 Jul 2008 14:52 Titel: Verfasst am: 28 Jul 2008 14:52 Titel: |
 |
|
aus dem aktuellen FD:
Schöne neue Bilderwelten artikel / kino
Spekulationen diesseits und jenseits der Digitalisierung
Von Anfang an, seit der Mensch Bilder produziert, gab es drei Gründe, die Bilder laufen zu lassen:
1. Um natürliche Vorgänge zu reproduzieren: Menschen bauen einen Obelisken auf. Die Sonne scheint darauf. Auf dem Boden bildet sich der Schatten ab und wandert im Uhrzeigersinn. Mit einem Stock kann der Mensch die Phasen auf der Erde markieren. Auf diese Weise vermag er den Lauf der Sonne und der Gestirne festzuhalten und zu simulieren. Zuerst geht der Blick der Bewegtbilder-Macher himmelwärts. Es gibt die These, dass im Stiersaal der Grotte von Lascaux bereits ein kompletter Tierkreis (Sternkonstellation) dargestellt ist.
2. Die Höhlenmalerei: Sie ist grundsätzlich kultischer Natur. Höhlenfeuer illuminiert die Kunstwerke stroboskopisch. Mehr als alles andere sind diese Höhlen die Vorläufer des Kinos.
3. Der Mensch selbst strebt danach, sich über Bilder, zumal bewegte, in höhere Sphären zu bewegen, sich selbst zu konservieren und als astrales Geistwesen in einer halluzinogenen Traumebene zu „verewigen“.
An diesen Phänomenen, an dieser Ausrichtung hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert: Es wird digital simuliert und kommuniziert. Es wird digital unterhalten. Und in naher Zukunft wird auf digitale Traumreisen, in virtuelle Parallelwelten „gebeamt“. Allerdings: All dies ist längst nicht mehr eine Frage der Qualität, sondern der Quantität. Die Bevölkerungsexplosion hat gleichzeitig zu einer Explosion der Bilder geführt. Seit George Lucas von einer „Demokratisierung der Produktionsmittel“ sprach und seit „YouTube“ zur globalen Verbreitung beiträgt, fühlt sich ein jeder zur Bildproduktion berufen, auch bloße Amateure und Dilettanten. Dank der Digitalisierung findet parallel zur Vermehrung der Bilder auch eine der Trägermedien statt. Daraus folgt, dass die etablierten Medien zur Projektion oder Übertragung bewegter Bilder, das Kino, aber auch das traditionelle Fernsehen, ihre Zentralität eingebüßt haben.
Allein 2007 wurden beispielsweise in China 102.000 Sendeminuten digitale Animation hergestellt, Tendenz steigend. So erwartet Beijing, nicht zuletzt dank der Olympischen Spiele, ein Wachstum der Animationsindustrie um 50 Prozent pro Jahr, mit einem jährlichen Umsatz von bis zu vier Milliarden Yuan (512,8 Mio. Dollar) noch vor 2010. Rivale Guangzhou strebt im selben Zeitraum sogar einen Gewinn von siebeen Milliarden Yuan (897,4 Mio.) an. Im Firmenpark, den die Stadt Suzhou 2005 eröffnete, haben sich inzwischen 40 Unternehmen dieser Branche angesiedelt, die es 2006 auf einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Yuan (128 Mio. Dollar) brachten. Grund sind staatliche Direktiven, auf die Wirtschaftskraft animierter Bilder zu setzen und eine „starke Nation der Animation“ aufzubauen. Am schnellsten mutierte der ehedem noch handgezeichnete, an Disney orientierte Cartoonfilm in Shanghai. Angesagt sind Flash-Animation, Mobile Phone Contents und Computerspiele. Für die Animationsindustrie in Shanghai machen die Internet-Spiele bereits 70 Prozent des Umsatzes aus. Nach einer Statistik beschäftigen sich in Shanghai 8836 Firmen mit neuen digitalen Medien, darunter einhundert ausländische Unternehmen. Animation und Spiele sind fraglos beherrschende Medienthemen des 21. Jahrhunderts.
Mechanisches und digitales Kino
Das Kino, wie wir es kennen, war ein Produkt des mechanischen Zeitalters, d.h., die Filmbänder wurden mechanisch transportiert und projiziert. Sein Sterben war im Grunde ein jahrzehntelanger Prozess: vom Stummfilm zum Tonfilm, durch die Bombardierung der Spielstätten im Zweiten Weltkrieg, durch den (im Endeffekt) erfolglosen Kampf gegen die Television. Inzwischen ist sogar die einst bedeutendste Kinomeile Europas, der Kurfürstendamm in Berlin, so gut wie kinofrei. Für das, was blieb, ist eine (noch prohibitiv aufwändige und teure) Digitalisierung vorgesehen. In dem Moment, da auch das Kino, anfangs noch zögerlich und nicht immer erfolgreich, digitale Techniken adaptiert, wird klar, dass es eines Tages geschluckt wird, seine zeitweilige Zentralität einbüßt und im digitalen Environment aufgehen wird. Moving Images kann man im Fernsehen ebenso abrufen wie im Internet.
Das Kino versucht seine Rolle heute insbesondere über Events zu sichern. Zu den Events der digitalen Welt gehören eher nicht die kleinen Produktionen (die sind mehr etwas für DVD oder besser noch Video on Demand), sondern Visual-Effects-Blockbuster, in den nächsten Jahren auch gern wieder in 3D-Stereoskopie; doch mit dieser Politik gerät das Kino an die Grenzen ökonomischer Vernunft.
Douglas Trumbull, der an den Filmeffekten von Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ mitgearbeitet und den ökologisch motivierten Weltraumfilm „Silent Running“ inszeniert hat, ist schon länger skeptisch, was die Inflation der Budgets bei dürftiger Ideenlage angeht, wie man sie gerade im amerikanisch dominierten Kino immer deutlicher feststellen kann. Es wimmle in den großen Studios von leitenden Angestellten, die nur noch in Megabudgets denken und kleinere Filme aus machtpolitischen Gründen selten schätzen. All dies sei aber nur noch Selbstbefriedigung einer überlebten Aristokratie: „Was, wenn aus derartiger Gigantomanie am Ende nach Abzug aller Kosten nur ein magerer Profit von fünf Mio. Dollar herausspringt? Ich weiß nicht, wie die Studios mit diesem vermessenen Geschäftsgebaren überleben wollen.“ Hollywood, so Trumbull, sei Glücksspiel, nicht mehr.
Interaktive Bilderkulturen
Gingen in den ersten 15 Wochen des Jahres 2002 noch 440 Millionen zahlende Gäste ins Kino, waren es drei Jahre später nur noch 380 Millionen. Der Rückgang ist dramatisch und unaufhaltsam. Die Krise ist strukturell. Denn mit dem Siegeszug der (Personal-) Computer geht ein ungeheuerlicher ökonomischer, technologischer und narrativer Paradigmenwechsel in der (Schein-)Welt der flimmernden Bilder einher; unsere Gesellschaft, die sich inzwischen primär durch Bilder definiert, muss nun auch B sagen. Morgen wird das, was heute noch Blockbuster heißt, vielleicht nur noch Promotion für Merchandising oder ein interaktives Spiel sein. Und übermorgen hängt es uns schon zum Halse heraus. Bereits heute sind die Halbwertszeiten einer jeden in bewegten Bildern erzählten Geschichte vergleichsweise kurz und tendieren gegen Null. Deutliche Zeichen einer schnelllebigen Zeit und der schier unfassbaren Inflation der Bilder in Fernsehen, Werbung und Internet; wer erinnert sich etwa noch der fast 500 Filme, die 2007 in deutschen Kinos angeboten wurden?
Die Bilder sind flüchtig, meint auch Helmut Herbst, und stellt dazu fest: „Die Flucht der Bilder durch die Medien begann gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit Robertsons Projektion von Geisterbildern. Seitdem benutzen diese Geisterbilder auf ihrer Flucht die jeweils neuesten Medien. Das Bild wird zum bewegten Bild, es verlässt die Architektur, die Kathedrale, den bürgerlichen Salon, so wie es demnächst auch das Kino verlassen wird. Am Ende ihrer medialen Fluchtbewegung werden die Bilder nirgends und überall sein und das in unübersehbarer Fülle.“
Die Zauberworte heißen nicht mehr Glotze oder Kino, sondern Cross-Media, IPTV, Mobile Phone, ADSL-TV, usw. Alles und jeder ist digital vernetzt. Digital lässt sich alles kopieren, alles herbeizaubern, alles mit schier göttlicher Fantasie kreuzen: sprechende Löwen, Zentauren mit Pferdeschwanz, geflügelte Einhörner. Das Internet, fährt Helmut Herbst fort, sei eine der letzten Stufen auf dem Wege der Verflüchtigung der Bilder: Alle Versuche, es in einen Kramladen mit Schubladen und einer Kasse am Ausgang zu verwandeln, glichen dem sprichwörtlichen Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln.
Die Sprache des Computers ist interaktiv, also werden es auch die Geschichten sein. Dazu Douglas Trumbull: „Das Geschäft mit interaktiven Spielen ist heute schon viel umfangreicher als das gesamte Filmgeschäft und wächst weiter. Das beweist, dass es einen ungeheuren Markt für Interaktivität gibt. Aber die Geschichten stecken noch in den Kinderschuhen und gehen selten über reine Ballerspiele (Ego-Shooter) hinaus.“ Das wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach bald ändern. Wir müssen gewärtigen, dass die Game-Produzenten innovativ sind und dass ihnen bewusst ist, dass künstliche Figuren auch künstliche Intelligenz besitzen müssen, um den Reiz der Interaktivität zu erhöhen. (Begonnen hatte es, wie mancher sich vielleicht noch erinnert, mit der Tamagotchi-Hysterie.) Die bange Frage, wie mit einer digitalen Matrix aus künstlichen Geschöpfen umzugehen sei, hat bereits der 1976 verstorbene Science-Fiction-Autor Daniel Francis Galouye in seinem Buch „Simulacron-3“ aufgeworfen, das von Rainer Werner Fassbinder unter dem deutschen Titel „Welt am Draht“ verfilmt worden war.
Damit werden natürlich auch die Regeln konservativer Dramaturgie zur Disposition gestellt. Denn die Figuren schreiben sich ihre „Geschichten“, wenn auch in einem vorher klar umrissenen Environment, in Interaktion mit dem User selbst. Nur noch Umfeld und Figuren sind durch die Software definiert. (Die Kunst, Geschichten geradlinig zu erzählen, droht in der Zapping-Kultur ohnehin verloren zu gehen.) Das Kino aber wird, als Publikumsmedium, passiv bleiben müssen: Nonlineare Dramaturgie ist ihm fremd.
Auch eine Frage der Ethik
Der Anschlag auf die Twin Towers in Manhattan hat in den Explosiv- und Special-Effects-Medien vor dem 11. September 2001 begonnen: In Jack Golds „The Medusa Touch“ von 1979 rammte ein Passagierflugzeug ein Hochhaus, ebenso wie in einem perfiden Werbespot der Telekom, der nur ein einziges Mal vor dem Terroranschlag gesendet und dann mit hochrotem Kopf aus dem Verkehr gezogen wurde. Visuell betreut wurde der peinliche Spot von Joachim Grüninger, der gelegentlich auch mit Roland Emmerich arbeitet. Letzterer zerstörte zur Gaudi des Publikums in „Independence Day“ Wolkenkratzer gleich im Dutzend und dazu das Weiße Haus. Der „KulturSpiegel“ verwies in seiner Ausgabe 10/2001 auch auf die „Die Hard“-Reihe: „Zusammengenommen und um die Happy Ends gekürzt, ergeben diese Filme eine gruselige Blaupause für den Terroranschlag vom 11. September.“
Die Kultur- und Tugendwächter sehen schwarz für die Zukunft (und rufen Initiativen gegen die Computerspielsucht gewaltbereiter und/oder fettleibiger Kinder ins Leben). Zunehmender Autismus und Analphabetismus seien, so meinen sie, die Folge von Monitorkulturen, die die Menschen auseinander dividieren und kommunikativ auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner einer Monitorkonserve versammeln. So werden sie, wie es Anthony Burgess vor über 40 Jahren vorausgesehen hat, zu Uhrwerk-Orangen: „Clockwork Orange“. Das Medium übt einen quasi hypnotischen Reiz auf den bildersüchtigen User aus, und die digitalen Fälschungen der Bildmanipulatoren sind als solche oft nicht mehr zu erkennen, nicht einmal von Fachleuten. Wirklichkeit und virtuelle Realität fließen oft wie im Rausch zusammen. (Es gibt weltweit genügend Kräfte, die ihr politisch-fundamentalistisches und religiöses Kapital daraus zu schlagen wissen werden.)
Gegen diese Art von Manipulation ist kein Kraut, schon gar kein Gesetz gewachsen.
Bildtransfer ins Gehirn
Auf Grundlage dieser und ähnlicher Albträume jenseits der unbestreitbar kommunikativen und informativen Vorzüge des WorldWideWeb könnte im Endstadium, in mehr oder minder ferner Zukunft, die vollständige Infiltration des menschlichen Gehirns ermöglicht werden.
In der Cyberpunk-Science-Fiction eines William Gibson ist der Mensch direkt mit dem Rechner verbunden. Er muss lediglich ein Kabel in sein zentrales Nervensystem einführen. 1984, in seinem Roman „Neuromancer“, hatte Gibson dafür den Begriff „Virtual Reality“ geprägt: ein kybernetischer Weltraum, der über eine direkte Schnittstelle zum Gehirn bereist werden kann. Jaron Lanier von der Firma VPL, der in Kalifornien an einer neuen Form „post-symbolischer Kommunikation“ arbeitete, übernahm den Terminus technicus für eine von ihm angestrebte Symbiose von Interaktion und Austausch grafischer Simulationen. Zwar scheiterte die „Virtual Reality“ mit Datenhelm und Handschuh an den hohen Kosten der Systeme und der mangelnden Akzeptanz der teuren Headsets, aber die Grundidee, das Gehirn direkt zu vernetzen, blieb.
Tatsächlich hat die Projektion von Bildern ins menschliche Gehirn schon begonnen, wenn auch nur im medizinischen Bereich: getarnt als Sehhilfe für Blinde (Artificial Vision).
Neue mediale Ressourcen werden interdisziplinär geortet. George Lucas spekuliert über Virtuelle Realität oder Simulatorenritte, die man mit Biotechnik verbinden kann, um Nicht- und Parallel-Welten zu erzeugen. Man würde nichts weiter tun, als eine Pille einnehmen und dann schlafen gehen. „Es würde wie ein Traum sein, und man hätte die wirklich reale, körperliche Empfindung von etwas völlig Imaginärem“, beschwört er die eingangs zitierte archaische Traumebene. „Ich habe keine Idee, was das für die Gesellschaft bedeuten würde, und wie man dahin gelangt, aber ich weiß genug, um mir bewusst zu sein, dass es möglich ist. Weil sie nämlich schon dabei sind, Bilder zu schaffen, ohne sie wirklich aufzunehmen, ganz genauso wie es im Traum geschieht.“
Die Nackten und die Toten
Ja, brauchen wir denn synthetische Schauspieler, wo doch die Geburtenrate der Menschheit, wenigstens derzeit noch, explodiert? Auf der Leinwand wolle er auch künftig keine künstlichen Menschen sehen, sondern Schauspieler aus Fleisch und Blut, wünscht sich Volker Engel, „Oscar“-prämierter deutscher Special-Effects-Supervisor. Er vergisst, dass es nur künstliche Menschen sind, die man cross-medial und interaktiv übertragen kann.
„Ist der Mensch mit Bleistift und Zeichenblock nun ein antikes Fossil?“, fragte einmal besorgt die Filmkritikerin Ponkie. „Die Computergrafik könnte ihn jederzeit als prähistorisches Rechenexempel auf den Bildschirm zaubern. Wer weiß also, ob es uns überhaupt noch gibt?“ Sind wir am Ende wirklich eine Fiktion à la „Matrix“? Ist es überhaupt noch der Mensch, der sich bewegt, oder sind es nur noch seine Daten? In einem Fernsehinterview entwickelte Nadia Thalmann von der Universität Genf in aller Unbekümmertheit das Horrorszenario computererzeugter Nachrichtensprecher und Politiker: „Wir haben ihre Figur und können sie sprechen lassen – sie brauchen nicht dabei zu sein...“ Ganz gleich, ob sie leben oder schon tot sind.
Synthetische Parallelwelten
Der Tod ist bei der Erzeugung lebendiger Bilder, ob analog oder digital, vor dem Fernseher oder in einer virtuellen Traumebene, geradezu systemimmanent. Wenigstens auf dem Bildschirm will man ihm ein Schnippchen schlagen. Wie schon die ersten Daguerreotypien dazu benutzt wurden, frisch Verblichene, rechtzeitig vor der Bestattung, auf „Festplatte“ zu bannen, so wird auch der Computer mit dem Ziel eingesetzt, das vom Christentum seit zwei Jahrtausenden ersehnte „Wunder der Auferstehung von den Toten“ zu realisieren: Alien Resurrection.
Mein digitaler Avatar ist „unsterblich“ im WorldWideWeb, stellt somit eine erste Stufe zur Transzendenz dar: „...in diese Welt aus Bits kann man den Leib nur bedingt mitnehmen. Der Körper bleibt sozusagen außen vor, in der minderwertigen, vergänglichen Welt.“ (Angela und Karlheinz Steinmüller)
Die Rechnung geht soziokulturell auf, denn wo in der zivilisierten Welt gibt es denn noch den lupenrein natürlichen Menschen? In unserer Fantasie basteln wir am Menschen bereits in einer Weise, dass es die Realität der Gentechnik in den Schatten stellt. Wenn ich das Bild des Menschen im Computer manipulieren kann und darf, schwindet auch die Hemmschwelle in der Praxis des so genannten wirklichen Lebens.
Aber müssen wir immer nur im Kulturpessimismus baden? Können wir, trotz des Abgesangs auf die zukunftsbildende Kraft des Kinos, nicht auch die enorme wirtschaftliche Gestaltungskraft der vernetzten Bilderwelten sehen? Die Amerikaner begreifen so etwas nicht als Problem, sondern als „challenge“. Sollten wir nicht von Anfang an mit dabei sein und so rasch wie möglich eine virtuelle Infrastruktur aufbauen? Virtuelle Reisen in synthetische, interaktive Parallelwelten, so sie in didaktischer und ethischer Verantwortung konzipiert sind, werden möglicherweise unser Denken revolutionieren, wie es einst der Ackerbau tat. An den digitalen Realitäten kommen wir nicht mehr vorbei, aber so wie sie sind, müssen wir sie nicht unbedingt akzeptieren. Voraussetzung ist, dass an der Erforschung und Verbreitung nicht nur Technokraten beteiligt sind, sondern auch Personen, die sich ethisch verantwortlich fühlen.
gruss
helmut |
|
| Nach oben |
|
 |
cinéphile
Gast
|
 Verfasst am: 29 Jul 2008 06:44 Titel: Verfasst am: 29 Jul 2008 06:44 Titel: |
 |
|
| edit |
|
| Nach oben |
|
 |
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|